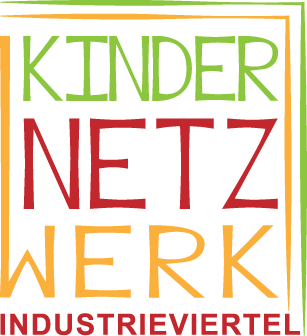Herzlich Willkommen auf der Homepage des Kindernetzwerk Industrieviertel!
RÜCKSCHAU AUF DIE 18. NETZWERKTAGUNG
inkl. Vorträge, Fotos, Zusammenfassung und Playlist
Kinder und Jugendliche mit psychosozialen Schwierigkeiten finden im interdisziplinären Kindernetzwerk Industrieviertel ein verantwortungsvolles Gegenüber, welches durch individuelle bestmögliche Hilfe verbesserte Lebensperspektiven eröffnet.
Unser Ziel
Kinder und Jugendliche mit psychosozialen Schwierigkeiten finden im interdisziplinären Kindernetzwerk Industrieviertel ein verantwortungsvolles Gegenüber, welches durch individuelle bestmögliche Hilfe verbesserte Lebensperspektiven eröffnet (Leitziel).
Um sicher zu stellen, dass die Aktivitäten im Netzwerk zielgerichtet und nicht chaotisch erfolgen, wurde ein ausführlicher und fundierter Zielorientierungsprozess durchgeführt.
Ausgehend von einer „Vision“ die allen Beteiligten als Leitziel der gemeinsamen Grundausrichtung dient, wurden Schwerpunktbereiche definiert, die sog. Mittlerziele, die zum Leitziel hinführen.
Anschließend wurden Handlungsziele erarbeitet, das sind konkrete Teil-Projekte, die in den einzelnen Gruppen umgesetzt werden.
So ist die Entwicklung von einer theoretischen Zielpyramide (siehe Download) zu einem mit realen Zielen und Projekten gefüllten Gesamtbild gelungen.
Was ist das Kindernetzwerk?
Das Kindernetzwerk Industrieviertel ist eine Basisinitiative von Menschen in helfenden Einrichtungen, die mit Mitteln des NÖGUS finanziell unterstützt wird und wissenschaftliche Begleitung erhält. Aus fünf politischen Bezirken machen sich Mitarbeiter*innen und Expert*innen seit 2006 aus den vier großen Zuständigkeitsbereichen
Gesundheit – Soziales – Bildung – Arbeit
auf den spannenden Weg, sich systematisch und strukturiert in ihrer Arbeit für Kinder und Jugendliche mit psychosozialen Schwierigkeiten zu vernetzen. Ein erfolgreicher Weg, wie die Wissenschaft weiß und die Erfahrung im Projekt bestätigt. In einigen Teilprojekten erarbeiten wir Modelle der Kooperation, diese kann man unter Projekte & Arbeitskreise nachlesen und verfolgen.